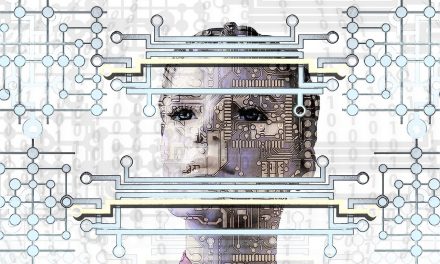Gastbeitrag, Berlin wird von einer rot-rot-grünen Koalition regiert und kommt für viele trotzdem in Sachen Wohnungspolitik nicht richtig aus dem Quark. Wir haben Vorschläge der Interventionistischen Linken dokumentiert. Die folgenden Auszüge stammen aus der Broschüre: „Das Rote Berlin – Strategien für eine sozialistische Stadt“

SAND AUF LANDESEBENE
Mietrecht ist Bundesrecht, aber die Wahrnehmung der Rechte der Mieter*innen könnte durch Beratungsstellen in den Bezirken unterstützt werden.
Wenn mehr Menschen ihr Recht kennen und durch Beratung und Rechtshilfe bei Prozessen gegen den Vermieter gestützt werden, werden Mietpreiserhöhungen insgesamt gedämpft. Auch gezielte Beratung gegen die um sich greifende Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt ist notwendig.
Bis 1988 galt in Berlin sogar eine offizielle Mietpreisobergrenze. Diese wurde jedoch abgeschafft und die Wiedereinführung von Mietpreisobergrenzen im Rahmen der Milieuschutzverordnungen von bundesweiter Rechtsprechung gekippt. Dennoch könnte die Zahnlosigkeit des Milieuschutzes durch mehr Eingriffsrechte der Bezirke verbessert werden. Scharfe Kontrollen von bisher wirkungslosen Verordnungen wie dem seit 2016 geltenden Verbot der Umwandlung von Miet- in Ferienwohnungen wären sofort möglich. Dasselbe gilt für das Verbot von Luxussanierungen, das auch im Milieuschutz unterlaufen wird. Auch mehr Personal für die Prüfung und Umsetzung des Vorkaufsrechtes der Bezirke wären sofort umsetzbar.
Auch die Grunderwerbssteuer kann Berlin jetzt schon erhöhen. Das Schöne dabei ist, dass diese nicht nur spekulationsdämpfend wirkt, sondern auf Grund des Normierungsverfahrens beim Länderfinanzausgleich die Mehreinnahmen zum größten Teil beim Land Berlin verbleiben würden.
Oben wurde dargestellt, wie die Grundsteuer auf Bundesebene zu einer Luxussteuer umgebaut werden könnte. Das Land Berlin könnte eine Luxuswohnsteuer jedoch auch eigenständig als Verbrauchssteuer einführen. Diese müsste dann zwar von den Mieter*innen bezahlt werden, kann aber durch eine Staffelung so konzipiert werden, dass nur diejenigen viel zahlen, die sich auch Luxuswohnungen leisten können.
All diese Möglichkeiten werden bisher kaum oder wenig genutzt. Auf der Bezirks- und Landesebene dominiert die Idee, dass Immobilienunternehmen „Partner“ bei der Bereitstellung von Wohnungen oder Wirtschaftsfaktoren seien, die die Konjunktur ankurbeln. Diese Flausen müssen wir der Landespolitik austreiben.
WIR FORDERN AUF LANDESEBENE
- Erhöhung der Grunderwerbssteuer.
- Einführung einer Luxuswohnsteuer als Verbrauchssteuer, bis zur Reform der Grundsteuer auf Bundesebene.
- Flächendeckende kostenlose Beratung in Miet- und Antidiskriminierungsrecht.
- Durchsetzung und Kontrolle aller Möglichkeiten zur Beschränkung der Verwertung von Wohneigentum.
WOHNGELD UND HARTZ IV
Steigende Mieten sind nicht nur eine Last für den Einzelnen, sondern werden vielfach noch von Steuergeldern subventioniert: Wohngeld und Hartz IV-Leistungen fließen direkt an die Vermieter*innen. So notwendig dies aktuell auch ist, um Verdrängung zu verhindern – langfristig macht dieses System keinen Sinn.
Denn hier wird öffentliches Geld an private Vermieter*innen umverteilt, ohne dass sich an der Wohnungsnot etwas ändert. Sinnvolle Wohnungspolitik wäre es stattdessen, einen bezahlbaren öffentlichen Wohnungsmarkt aufzubauen, der Subventionen wie beim Wohngeld unnötig macht. Bei staatlich unterstützten Menschen ohne Einkommen würde dagegen die Leistung wenigstens zurückfließen an öffentliche oder gemeinnützige Vermieter*innen und somit gemeinwohlorientiert reinvestiert werden.
Wohngeld
Das Wohngeld ist eine kommunale Leistung, die an Menschen mit Niedriglöhnen ausgezahlt wird. Sie ist mit weniger Schikanen verbunden als beim Hartz IV-Bezug, aber die Bearbeitungszeiten sind so lang, dass viele vom Antrag absehen. Die Bescheide sind zudem für Menschen ohne juristische Kenntnisse schwer verständlich.
Notwendig wäre daher kurzfristig eine personelle Aufstockung der Wohngeldämter, ein Abbau der überlangen Bearbeitungszeiten, eine Vereinfachung des Schriftverkehrs und persönliche Ansprechpartner*innen in den Bezirksämtern anstatt anonymem Papierkrieg.
Hartz IV
Das Hartz IV-System ist für einkommensschwache und erwerbslose Mieter*innen ein vielfacher Fluch. Es zwingt in unterbezahlte und kaum aushaltbare Jobs, es verletzt mit seinen ständigen Gängelungen die Menschenwürde, sorgt für Scham bei allen, die auf Hartz IV angewiesen sind, und verhindert mit einem viel zu geringen Existenzminimum Teilhabe an der Gesellschaft. Zusätzlich sind für Hartz IV-Empfänger*Innen die sogenannten „Kosten der Unterkunft“ (In Berlin in der Ausführungsverordnung Wohnen festgesetzt) so niedrig angesetzt, dass sich diese die steigenden Mieten in den Stadtzentren nicht mehr leisten können und zunehmend an den Stadtrand verdrängt werden. Denn wer die „Angemessenheitskriterien“ der Jobcenter nicht erfüllt, wird aufgefordert, die Aufwendungen, d.h. die Miete, zu senken. Wer nicht umziehen kann oder will, muss die Differenz zwischen der realen Miete und den zugestandenen „Kosten der Unterkunft“ aus dem ohnehin schon zu niedrigen Regelsatz zahlen. Viele rücken auch dichter zusammen, etwa, indem Zimmer untervermietet werden oder z.B. die Großeltern mit in die Familienwohnung ziehen. Dieses System ist skandalös und gehört abgeschafft. Langfristig muss Arbeit demokratisch verteilt und organisiert werden, bis dahin müssen Menschen ohne Lohnarbeit bedarfsgerecht und ohne Schikanen unterstützt werden.
Auf dem Mietmarkt sind die einzigen, die von dieser Praxis der Jobcenter profitieren, die Vermieter*innen, denen ihre Mieteinnahmen garantiert werden. Gerne wird die Miete bis an den Höchstsatz des Jobcenters erhöht. Oft ist jedoch eine Überschreitung des Satzes, Rausschmiss und Neuvermietung lukrativer. Auch dabei helfen Jobcenter und Staat. Bei Wechsel der Eigentümer*in etwa bezahlt das Jobcenter oft zu spät, weil die neuen Kontodaten nicht ankommen. Das Bürgerliche Gesetzbuch erlaubt jedoch bei Mietverzug von drei Monaten die sofortige Kündigung. Die Schludrigkeit der Jobcenter hat so schon viele Menschen die Wohnung gekostet – ein Skandal, der abgestellt werden muss. Mietverzug ohne eigenes Verschulden darf kein Kündigungsgrund sein.
Wir brauchen eine Anpassung der Hartz IV-Regelungen an die realen Bruttowarmmieten, auch wenn das erst einmal weiter zu viel Geld in die Taschen profitorientierter Investor*innen spült. Sonst haben wir bald nur noch Reichenghettos in der Innenstadt und das Recht auf freie Wahl des Wohnorts wird noch leerer als bisher. Selbstverständlich gilt diese Anpassung nicht nur für die Kosten der Unterkunft beim Arbeitslosengeld, sondern auch für Grundsicherung, Asylbewerberleistungsgesetz, das Wohngeld etc. Welche Wohnflächen dabei als angemessen gelten, muss sich auch an den vorhandenen Wohnungen im Gebiet orientieren. Dabei sollte auch „Sonderbedarf“ berücksichtigt werden – beispielsweise bei Rollifahrer*innen oder „Sondersituationen“, also etwa wenn bei einem Senior*innenpaar eine Person stirbt.
Das langfristige Ziel kann jedoch nicht sein, durch höhere Wohngeldsätze und mehr Geld für die „Kosten der Unterkunft“ private Vermieter*innen dauerhaft zu finanzieren. Ziel ist eine politische Wende, weg von einer Subvention privater Vermieter*innen hin zum Aufbau eines öffentlichen Wohnungsbestandes. Im Fachjargon: von der Subjektförderung (Geldzahlungen über einzelne Mieter*innen an Vermieter*in), hin zur Objektförderung (Förderung günstigen Wohnraums für alle). Dies wäre die Umkehrung des seit Beginn der 1990er Jahre anhaltenden Trends der Förderung der privaten Wohnungswirtschaft.
WIR FORDERN
- Weg mit Hartz IV, für bedürfnisgerechte Unterstützung ohne Schikanen.
- Langfristiges Ziel ist die Abkehr von der Subvention privater Vermieter*innen durch Wohngeld und „Kosten der Unterkunft“ im Hartz IV-System hin zu einem öffentlich organisierten Wohnungsmarkt, der bezahlbare Mieten bereitstellt.
- Für den Übergang: staatliche Leistungen müssen an real vorhandene Wohnflächen und Mieten angepasst werden
WOHNRAUM FÜR ALLE – AUCH FÜR GEFLÜCHTETE
Berlin gehört zu den wenigen Bundesländern, die die Gesetzgebung bezüglich der Unterbringung von Geflüchteten liberal auslegt. Demnach gilt: Mit Ausnahme der Personen, die aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten kommen, dürfen alle Geflüchteten spätestens nach sechs Monaten in eine eigene Wohnung ziehen. Einzige Bedingung für die Übernahme der Miete durch das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF, ehemals LaGeSo): Sie muss sich in ähnlichen finanziellen und die Wohnung in flächenmäßigen Rahmen bewegen wie bei Bezieher*innen von Hartz IV. Der geltenden Gesetzesgrundlage zufolge benötigte das Land also nur eine geringe Anzahl von Erstaufnahmeeinrichtungen. Wir fordern eine entsprechende radikale Kursänderung in der Politik.
Verantwortungslos und zynisch ist die Realität spätestens seit dem sogenannten „Sommer der Migration“ 2015. Ein Beispiel: Im Mai 2016 lebten 28 000 Menschen, darunter Familien, alleinerziehende und allein reisende Frauen, in Notunterkünften (NUKs), die die Standards von Erst- und Gemeinschaftsunterkünften weit unterschritten. Geflüchtete mussten und müssen teilweise noch in Turn- und Messehallen und Flugzeughangars schlafen und leben ohne die Möglichkeit sich zurückzuziehen oder selbst zu kochen. Die Räumlichkeiten bieten keinen oder kaum Schutz vor (sexualisierter) Gewalt. Auch mit dem Sicherheitspersonal, das in den Notunterkünften verstärkt eingesetzt wird, gibt es immer wieder eine Vielzahl von Problemen, die bei Ärgerlichkeiten beginnen und bei Rassismus, Gewalt und Erpressung enden. Zwar ist seit dem Regierungswechsel 2016 Bewegung in diese Situation gekommen, gänzlich verschwunden sind die Notunterkünfte jedoch immer noch nicht.
Der Schwarz-Rote Senat hat 2016 schleppend und in der Ausrichtung rückschrittlich und rassistisch reagiert. Mit der Planung und dem Bau von Gemeinschaftsunterkünften (sog. Tempohomes, also Containerdörfern) und modularen Unterkünfte für Flüchtlinge (MUFs) wurde ein neuer Sub-Standard durchgesetzt, ein Wohnen zweiter Klasse. Mittel- und langfristig ist dieses Vorgehen auch von einem finanziellen Gesichtspunkt aus widersinnig. Denn seit vielen Jahren ist bekannt, dass die Finanzierung von Betreiber*innen und Gemeinschaftsunterkünften teurer ist als die Unterbringung von Geflüchteten in ganz normalen Wohnungen. MUFs und Gemeinschaftsunterkünfte sind zudem eine verführerische Bereicherungsmöglichkeit für Betreiber*innen. Dubiose Unternehmen haben in kurzer Zeit Millionen an den Geflüchteten verdient, ohne sich allzu viele Gedanken um menschenwürdige Unterkünfte zu machen.
Da die neuen Gemeinschaftsunterkünfte ein tatsächlicher Fortschritt gegenüber den von fragwürdigen Betreibern aus dem Boden gestampften Notunterkünften waren, die alle bau-, hygienisch und gesundheitsrechtlichen Vorschriften unterschritten, waren die Stimmen gegen diese Planung gering. Die Gemeinschaftsunterkünfte wurden verkauft als einziger und schnellstmöglicher Ausweg aus der untragbaren Situation in Turn- und Messehallen.
Aus den Notunterkünften ziehen die Neuberliner*innen nun also in Tempohomes und MUFs. Wir lehnen jedoch auch diese strikt ab, denn hier wird das „Recht auf Wohnen“ gegen Unterbringung zweiter Klasse eingetauscht.12 Im Gegensatz zu den Containerdörfern werden die sogenannten MUFs zudem auf Dauer bestehen. Ihre zukünftige Umnutzung mit anderen, einkommensschwachen Bevölkerungsgruppen wie Senior*innen und Studierenden war von vornherein eingeplant. Unsere Kritik richtet sich hier nicht grundsätzlich gegen eine modulare Bauweise. Auch die kann schön und wohnlich sein. Der Standardentwurf der Landesregierung von 2016 sah allerdings ohne Not eine ausschließliche Nutzung als Gemeinschaftsunterkunft vor, anstatt aus den Fertigbau-Modulen richtige Wohnungen zusammenzusetzen.
Zudem hat die Planung etliche architektonische Mängel – überdurchschnittlich viel Quadratmeter für Flurwege, sehr kleine Räume ohne Tageslicht13 und vieles mehr. Als umzäunte Einheit mit Security-Eingang sondert diese Architektur die Bewohner*innen von der Nachbarschaft ab. Mit den MUFs wird so durch die Hintertür ein neuer Substandard in der Bauweise etabliert. Proteste von Architekt*innen und Aktivist*innen führten immerhin dazu, dass mittlerweile nach diesem Entwurf keine modularen Unterkünfte mehr gebaut werden. Über die neuen Entwürfe ist allerdings nicht viel bekannt. Doch trotz dieses Erfolges wird das Recht der neuen Berliner*innen auf Wohnraum, die aus verschiedenen Regionen vor Armut, Krieg und Verfolgung geflüchtet sind, weiter ausgehebelt. Selbst da, wo nicht mehr die Unterbringung in großen Gemeinschaftsräumen geplant ist, sollen die neu errichteten Gebäude nicht als normaler Wohnraum, sondern zur „Flüchtlingsanschlussunterbringung“ genutzt werden, wie es im Beamtendeutsch heißt. Mit dieser Planung kann auch dort gebaut werden, wo die Errichtung von richtigen Wohnungen wegen fehlender Infrastruktur bisher nicht erlaubt ist. Dazu hat 2016 das Land Berlin extra die Berliner Gesellschaft zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften (BEFU) gegründet. Dies schließt die Bewohner*innen auch von den bescheidenen Mitbestimmungsmöglichkeiten der sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen aus.14
Das Land Berlin muss sich auch in Bezug auf die Geflüchteten auf den Ausbau des sozialen Wohnungsbaus konzentrieren und Erstaufnahmeeinrichtungen nur in dem nötigsten minimalen Zahlen betreiben. Mehr städtische Wohnungen bedeuten auch mehr Spielraum und mehr Menschenwürde bei der Unterbringung von Geflüchteten.
Wir fordern des Weiteren, dass sich die Landesregierung dafür einsetzt, die schlechtere Behandlung Geflüchteter aus sogenannten sicheren Herkunftsländern auch in Bezug auf das Wohnrecht aufzuheben und die Wohnsitzauflage, die inzwischen selbst für anerkannte Geflüchtete für fünf Jahre gilt, aufzuheben.
Wir benötigen zudem sehr viel mehr Beratungsstellen, die Geflüchteten bei der Wohnungssuche unterstützen, und Beschwerdemöglichkeiten für Personen, die auf dem Wohnungsmarkt rassistisch diskriminiert werden. Um dem entgegenzuwirken, muss es in entsprechender Zahl auch mit den Wohnungsgesellschaften vereinbarte Kontingente „Wohnungen für Geflüchtete“ geben. Auch der Wohnberechtigungsschein muss für Geflüchtete, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus, ausgestellt werden.
Gegenwärtig verhindert das langsame Handeln des LAF immer wieder, dass Geflüchtete erfolgreich Mietverträge abschließen können. Die Landesregierung muss die Behörde so reformieren, dass spontanes Vorsprechen für Menschen, die eine Zusage vom Vermieter haben, möglich ist.
Unser Ziel ist, die gemeinsamen Interessen von Geflüchteten und Altberliner*innen auf dem Wohnungsmarkt in gemeinsamen Aktionen zu artikulieren. Dazu gehört auch, dass Proteste von Geflüchteten gegen ihre (Massen-)Unterbringung als „normale“ Mieter*innenproteste wahrzunehmen, die von den stadtpolitischen Initiativen Berlins breiter unterstützt werden sollten. Ein Abschieben der Zuständigkeit an antirassistische Initiativen darf es nicht geben.
Dies muss ebenso für die steigende Zahl der Obdachlosen gelten, die auch von Bezirkbürgermeister*innen der Grünen und der SPD im Jahr 2017 in menschenverachtender Weise als „Problem“ behandelt wurden, was einfach weggeräumt werden kann.
Das Problem sind nicht Menschen, die in Berlin leben und leben wollen, sondern die sozialen Verhältnisse – insbesondere die Krise der Wohnraumversorgung. Hervorgerufen durch den privaten Markt, den darin handelnden profitorientierten Akteur*innen und ihren Verbündeten in Politik, Verwaltung und Justiz.
AUSBAU ÖFFENTLICHEN EIGENTUMS- REKOMMUNALISIERUNG
Auch die landeseigenen Wohnungsunternehmen haben von den alten Förderprogrammen für den sozialen Wohnungsbau profitiert. Dennoch können sie zu einem Gegenmodell zur Förderung der Sozialwohnung im Privatbesitz ausgebaut werden. Beim kommunalen Wohnungsbau wurde nicht privaten Profiteur*innen öffentliches Geld hinterhergeworfen, sondern hier bauten landeseigene Gesellschaften wie die Degewo, Howoge und andere. Ihre Tradition reicht teilweise bis in die 1920er Jahre zurück, als der öffentliche Wohnungsbau Teil eines breiten sozialdemokratischen Reformprogramms war. Auch die SPD wollte damals eine „Gemeinwirtschaft“ aufbauen, in der Mieteinnahmen nicht privat angeeignet wurden, sondern in öffentlichen Wirtschaftskreisläufen verbleiben, das heißt ein Vorgriff auf eine sozialistische Gesellschaft. Finanziert wurde das Ganze aus Steuern auf Immobiliengewinne, die sogenannte Hauszinssteuer. Diese Zeiten sind jedoch vorbei.
Bereits seit den 1990er Jahren wurden die Kommunalen Bestände nicht zur Bereitstellung günstigen Wohnraums genutzt, sondern als Sparschwein zur Sanierung des Landeshaushaltes verwendet. Gegenseitige Übernahmen (sogenannte „in-sich Verkäufe“) und Mietsteigerungen sollten Ein-nahmen zur Stopfung von Haushaltslöchern bringen. In den 2000er Jahren wurde dann das Schwein geschlachtet: Die Privatisierung von Gesellschaften wie der Gemeinnützigen Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft (GSW) brachte zehntausende von Wohnungen in die Hände privater Finanzinvestoren. Als Resultat stellen die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin mittlerweile nur noch 20% des Wohnungsbestandes bereit.
Höchste Zeit also, um neu über kommunalen Wohnungsbau und Rekommunalisierung abseits der privaten Bau-Subventionierung nach dem alten Filzmodell nachzudenken.
Um Rekommunalisierungen zu ermöglichen, braucht es effektive Instrumente und politischen Willen sowie Durchsetzungsfähigkeit gegenüber privaten Investor*innen. Dies gilt für Rekommunalisierung im engeren Sinne, also den Rückerwerb vormals städtischen, jedoch bereits privatisierten Wohnraums, aber auch für den Neubau sowie Ankauf von Wohnungen durch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften.
Um Wohnraum der Spekulation durch private Eigentümer*innen zu entziehen, müsste beispielsweise das kommunale Vorkaufsrecht aktiver durch die Bezirke genutzt werden. Hierfür müssten die Bezirke jedoch mit ausreichenden Mittel, etwa durch einen entsprechenden Fonds, ausgestattet werden, damit es nicht bei Einzelfällen bleibt.
Eine Finanzierungsmöglichkeit wären die im Kapitel „Sand im Getriebe“ erwähnten Steuererhöhungen auf Immobiliengewinne. Teile dieser Steuern wie die Grunderwerbssteuer sind auf Landesebene realisierbar. Notwendig wäre jedoch zusätzlich die Einrichtung eines zweckgebundenen Bundesförderprogramms für 100% kommunalen Wohnraum. Perspektivisch soll es so möglich
28 – Zweiter Schritt – Ausbau öffentlichen Eigentums
werden, durch massenweise Ankäufe Wohnraum in öffentliche und selbstverwaltete Strukturen zu überführen. Die langfristige Zielmarke der Rekommunalisierungsoffensive durch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften wäre hierbei die Bereitstellung von mindestens 80% des Berliner Wohnraums durch kommunale Unternehmen oder Genossenschaften und selbstorganisierte Wohnprojekte. Damit wäre die bloße „Re“-Kommunalisierung ausgeweitet auf eine Voll-Kommunalisierung. Nicht nur die einst privatisierten Bestände sollen in öffentliche und genossenschaftliche Hand, sondern die Mehrheit, wenn nicht die Gänze des Wohnungsbestandes – die Ausnahme wären Wohnungen die von den Eigentümer*innen selbst genutzt und bewohnt werden. Der private Markt wäre zurückgedrängt auf eine Nische, der öffentliche Bestand die Regel. Mieten wären somit kein Spielball des Marktes mehr, sondern Gegenstand politischer und demokratischer Aushandlung.
Um diese Zielmarke eines überwiegend öffentlich bzw. kollektiven Wohnungsbestandes zu erreichen und auch langfristig zu erhalten, braucht es ein striktes und ewiges Privatisierungsverbot der kommunalen Wohnungsbestände, um diese auch langfristig vor Zugriffen und wechselnden politischen Mehrheiten und Koalitionen zu schützen.
Um die Verwaltung der Bestände entsprechend der Bedürfnisse der Mieter*innen zu gestalten, muss mit der Rekommunalisierung der Bestände auch eine Erweiterung der Mieter*innenmitbestimmung, d.h. eine Demokratisierung der kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, einhergehen. Das langfristige Ziel ist hierbei die Vergesellschaftung der Wohnungsbestände, das heißt öffentliches Eigentum in Kombination mit demokratischer Verwaltung. Schritte auf dem Weg dorthin sind beispielsweise Mieter*innenmehrheiten in den Aufsichtsräten der landeseigenen Wohnungsunternehmen, wirksame und mit realen Kontrollrechten ausgestattete lokale Mieterratsstrukturen und die Änderung der Rechtsform von GmbHs und Aktiengesellschaften in Anstalten öffentlichen Rechts (AÖR) (Siehe dazu auch das Kapitel „Demokratisierung“).
WIR FORDERN
- Kommunales Vorkaufsrecht aktiv nutzen und finanziell ausstatten
- Investition neuer Steuern auf Immobiliengewinne für Ankauf und Neubau
- Zusätzlich ein Bundesprogramm zur Finanzierung rein kommunalen Wohnraums
- Privatisierungsverbot für landeseigene Wohnungsgesellschaften
- Kein Cent mehr für die private Bausubventionierung nach dem alten Filz- Modell
- Demokratisierung der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften
NEUE GEMEINNÜTZIGKEIT ALS STÜTZE DER REKOMMUNALISIERUNG
Wohnraum ist im Kapitalismus nicht nur zur Ware geworden, sondern zu einer spekulativen Geldanlage. Um Wohnraum für alle zur Verfügung zu stellen, muss Wohnraum vom Markt genommen werden, zum Beispiel durch Rekommunalisierung.
Die sogenannte Neue Gemeinnützigkeit, die gerade insbesondere von Grünen und Linkspartei diskutiert wird, ist ein Ansatz, der innerhalb des bestehenden Systems nach Möglichkeiten für die Förderung von sozial gebundenem Wohnraum sucht.17 Wohnraum, der nicht profitorientiert verwaltet wird, soll dabei steuerlich bevorzugt werden.
Historisch betrachtet gab es in Deutschland bereits eine Wohngemeinnützigkeit, die jedoch mit der Steuerreform 1989 abgeschafft wurde. Bei den gegenwärtigen Konzepten von Grünen und Linkspartei zur Neuen Wohnungsgemeinnützigkeit sollen Unternehmen und Genossenschaften, die weniger profitorientiert handeln (max. Gewinn von 4%), sondern nach sozialen Kriterien, bevorzugt werden. Soziale Kriterien in der gegenwärtigen Diskussion sind z.B. niedrige und einkommensabhängige Mieten, vorrangige Vermietung an Prekarisierte und Personen, die sich am freien Markt nicht selbständig mit Wohnraum versorgen können. Unternehmen, die diese Kriterien berücksichtigen, erhalten im Gegenzug Steuererleichterungen und den privilegierten Zugang zu Fördermitteln, Grundstücken und zinsgünstigen Darlehen. Somit kann die Neue Gemeinnützigkeit zu einer Stütze der Rekommunalisierung werden. Denn auf diese Weise können auch nicht-staatliche Unternehmensformen, die nicht profitorientiert handeln und selbstverwaltet sind, dauerhaft sozial gebunden und gefördert werden – neben kommunalen Fonds auch vom Bund . Zusätzlich wird es möglich, die kommunalen Wohnungsunternehmen dauerhaft zur Schaffung leistbaren Wohnraums in die Pflicht zu nehmen und Strukturen wie Genossenschaften und das Mietshäusersyndikat zu fördern. Aber führen uns solche Steuererleichterungen zu einer Vergesellschaftung von Wohnraum?
Damit die Neue Gemeinnützigkeit einen Schritt hin zu einer neuen Form der Wohnraumversorgung wird, muss sie unserer Meinung nach an kollektives Eigentum und demokratische Verwaltung gebunden werden. Nur öffentliches, genossenschaftliches oder in anderer Rechtsform kollektiviertes Wohneigentum sollte als gemeinnützig gefördert werden. Gleichzeitig müssen die Mieter*innen über dieses Eigentum in demokratischer Mitverwaltung oder Selbstverwaltung entscheiden können (Siehe dazu das Kapitel „Demokratisierung“).
Bisher wird mit der Neuen Gemeinnützigkeit jedoch meist nur darauf gesetzt, einfach möglichst schnell günstigen Wohnraum zu sichern. In manchen Konzepten können so Unternehmen auch nur bestimmte Bestände in die Gemeinnützigkeit überführen. Es geht dann nicht um eine neue Form des Wohnens, sondern es soll vor allem privaten Wohnungsunternehmen ein neues Geschäftsmodell angeboten werden, um im Gegenzug dauerhafte Sozialbindungen für Wohnraum zu sichern.
Wir denken, dass dies nicht weit genug geht und setzen uns für eine Förderung von Ansätzen der Vergesellschaftung durch eine Neue Gemeinnützigkeit ein. Durch die Bindung der Gemeinnützigkeit an öffentliches/kollektives Eigentum und Demokratisierung sollen Mieter*innen und Arbeitende in den Unternehmen ihr Lebens- und Arbeitsumfeld entsprechend ihrer Bedürfnisse bestimmen und demokratisch verwalten und gestalten können. So können jenseits von Staat und Kapital unter-schiedliche Formen der Selbstverwaltung geschaffen werden, in der die Schaffung eines guten Wohn- und Lebensraums eine kollektive Aufgabe ist. Nur durch ein paar Unternehmen, die für be-stimmte Bestände weniger profitorientiert handeln, wird der Wohnungsmarkt nicht demokratisiert und die Wohnraumbewirtschaftung an die Interessen der Arbeitenden, der Mieter*innen und der Bevölkerung ausgerichtet. Nur durch die kollektive Verwaltung von Wohnraum kann verhindert werden, dass in Krisenzeiten Wohnraum privatisiert oder profitorientiert verwaltet wird.
WIR FORDERN
- Neue Gemeinnützigkeit einführen und mit massiven Fördermitteln ausstatten
- Bindung der Gemeinnützigkeit an harte soziale Kriterien bei der Vermietungspraxis
- Bindung der Gemeinnützigkeit an öffentliches oder kollektives Eigentum
- Bindung der Gemeinnützigkeit an Entscheidungsbefugnisse für Mieter*innen und Arbeitende durch z.B mindestens paritätisch besetzte Aufsichträte und die Kontrolle der sozialen Vermietungskriterien durch MieterInnenräte